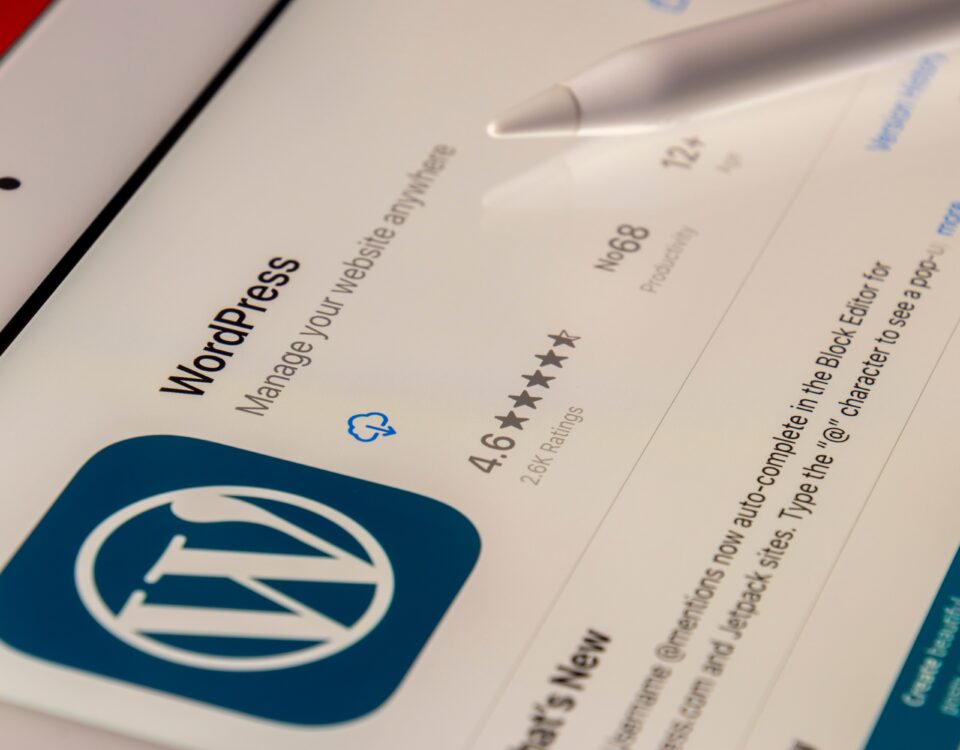Faktencheck auf Social Media: Wie funktionieren Community Notes und Co?

Falschinformationen verbreiten sich in sozialen Netzwerken oft schneller als fundierte Fakten. Um dem entgegenzuwirken, haben Plattformen wie X (ehemals Twitter), Instagram und andere verschiedene Werkzeuge für Faktenprüfung und Kontextbereitstellung eingeführt. Eines der bekanntesten Werkzeuge sind die „Community Notes“. Ausgerechnet in turbulenten Zeiten bezüglich Falschmeldungen und Halb-Wahrheiten auf Social Media beschließt Mark Zuckerberg, dass seine Meta-Plattformen wie Instagram und Facebook keine Fakten mehr checken werden. Was der Grund dafür sin könnte und wie diese Systeme funktionieren, beschreiben wir in diesem Artikel.
Community Notes: Faktenprüfung durch Nutzer
Die Funktion Community Notes, die auf der Plattform X zur Anwendung kommt und auch auf Meta-Plattformen eingesetzt werden soll, basiert auf dem Prinzip der kollaborativen Faktenprüfung. Registrierte Nutzer können Hinweise zu bestimmten Beiträgen verfassen, die dann von anderen Nutzern bewertet werden. Die Idee ist, dass verschiedene Perspektiven zusammenkommen, um irreführende Inhalte durch zusätzliche Kontexte und Quellen zu relativieren. Das Prinzip ist vergleichbar mit der Wikipedia. Hier können alle Beiträge schreiben, die belegt und von unterschiedlichen Personen freigegeben werden müssen.
Wie funktioniert der Bewertungsprozess?
- Beitrag markieren: Ein Nutzer kann einen Community-Hinweis zu einem Beitrag verfassen, den er für potenziell irreführend hält.
- Bewertung durch andere Nutzer: Andere Teilnehmer des Programms stimmen ab, ob der Hinweis nützlich ist.
- Veröffentlichung des Hinweises: Nur wenn die Bewertung eine ausreichende Anzahl von Nutzern mit unterschiedlichen Standpunkten erreicht, wird der Hinweis sichtbar.
Die Herausforderung liegt darin, eine möglichst breite Perspektive einzubringen, um parteiische oder einseitige Bewertungen zu vermeiden. Studien zur Effektivität von Community Notes zeigen gemischte Ergebnisse, wobei der Erfolg stark von der aktiven und ausgewogenen Beteiligung abhängt.
Faktenprüfung auf Instagram und Facebook
Meta, das Unternehmen hinter Facebook und Instagram, hat im Januar 2025 bekannt gegeben, dass es in den USA nicht länger mit externen Faktenprüfern zusammenarbeiten wird. Stattdessen setzt das Unternehmen nun auf ein Community-Notes-System, ähnlich dem von X. Diese Entscheidung markiert einen strategischen Wandel hin zu einer kollaborativen Faktenprüfung durch die Nutzer, berichtet unter anderem der Spiegel.
Vor der Umstellung auf Community Notes hat Meta Falschmeldungen auf Facebook und Instagram durch die Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern bekämpft. Diese Organisationen, die dem International Fact-Checking Network (IFCN) angehören, bewerteten verdächtige Inhalte und markierten fehlerhafte Beiträge. Warnhinweise und erklärende Links wurden hinzugefügt, während die Reichweite dieser Beiträge eingeschränkt wurde, um die Verbreitung von Desinformation zu minimieren.
Funktionsweise des neuen Systems
- Nutzerbeteiligung: Wie bei Community Notes auf X können Nutzer Hinweise zu Beiträgen geben.
- Bewertung durch die Community: Andere Nutzer stimmen ab, ob die Hinweise hilfreich sind.
- Sichtbarkeit: Nur von der Community als nützlich bewertete Hinweise werden prominent angezeigt.
Dieser Ansatz soll die Reichweite von Falschinformationen eindämmen und gleichzeitig die Transparenz erhöhen, da die Bewertungen direkt von den Nutzern kommen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob dieses System mit denselben Herausforderungen wie auf X konfrontiert sein wird.
Auswirkungen auf die Nutzer
Beide Ansätze zielen darauf ab, die Informationsqualität zu verbessern und Nutzer vor Desinformation zu schützen. Dennoch gibt es Debatten über die Wirksamkeit und Fairness dieser Systeme. Kritiker befürchten, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, während Befürworter argumentieren, dass die Gesundheit des öffentlichen Diskurses Vorrang haben sollte.
Fazit: Warum Meta den Faktencheck beendet
Ob Community-basierte Faktenprüfung oder professionelle Bewertungen – beide Modelle haben Stärken und Schwächen. Langfristig könnte eine Kombination aus beiden Ansätzen den besten Schutz vor Falschinformationen bieten. In Zeiten, in denen Falschmeldungen immer präsenter werden, lässt der Rückzug Metas von Faktencheck-Kooperationen nur den Schluss zu, dass man es sich mit dem kommenden Präsidenten Donald Trump nicht verscherzen möchte. Bis Ende des Jahres 2025 besitzt etwa das deutsche Netzwerk correcitv einen Vertrag mit Meta über deren Tätigkeit zum Faktencheck. Ob die Abschaltung weltweit umgesetzt wird oder auf die USA begrenzt bleibt, ist ungewiss.